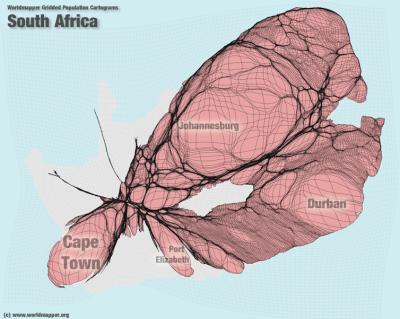Armin Thurnher
hat gewagt, sich kritisch über "das Internet" zu äussern, von der Netzcommunity als Hetzkommunity zu sprechen, und vom "Blöken" in den Blogs zu schreiben.
Vielfache Kritik schlug ihm in digitalen Medien (siehe dazu
Helges Beitrag samt der dort dokumentierten Beiträge) entgegen, und im
aktuellen falter wurden einige, darunter auch ich, gebeten, zum Thema social media und seine gesellschaftlichen Folgen zu schreiben.
Hier mein (verlängerter) Beitrag:
Freie Medien sind die Grundvoraussetzung der Demokratie, das Internet hat einen revolutionären Umbruch eingeleitet.
Ich will diesen an mir selbst beschreiben. Ich betreibe seit mehr als vier Jahren ein Blog, „bin“ bei Facebook und twittere. Ich kann mich ohne Umweg über Journalisten direkt an jene wachsende Zahl von Menschen wenden, die auf diesen Onlineplattformen aktiv sind. Sie schreiben zurück, ich lerne enorm viel von ihnen, bekomme Tipps und Kritik. Keine Frage, ich profitiere in höchstem Maße am Web, und verstehe nicht, warum nicht deutlich mehr Politiker/innen dieses direkte mittel des „digitalen Gesprächs“ nutzen.
Gleichzeitig stellen sich mir doch eine Reihe von Fragen:
Erstens: Wird „das Internet“ als Massenmedium nicht total überschätzt? Oder anders gefragt: Warum verstecken alle Medien ihre Zugriffszahlen hinter Verschleierungen? Die ÖWA (österreichische Webanalyse) misst akribisch genau, wie oft Webseiten besucht werden, listet die Ergebnisse aber in völlig irrelevanten Zahlen auf. Da wird zum Beispiel von zigmillionen "Unique Clients" pro Monat gesprochen. Ich alleine bin da schon drei davon: Laptop, PC und iPhone sind je ein Client?
Wenn man so wie bei "richtigen" Medien rechnet, nämlich Tagesreichweite bei Einzelmenschen, dann zeichnet sich ein anderes Bild ab.
ORF.at, der mediale Platzhirschen Nummer 1, kommt gerade einmal auf 0,2 bis maximal 0,3 Millionen Menschen pro Tag, beim
Online-Standard sind es laut Google Adplanner weit weniger als die Hälfte davon. Auf Angebote wie Wolfgang Fellners
OE24.at verirren sich nur noch ein paar Zehntausend Menschen pro Tag. Sind das Massenmedien? Zum Vergleich: Die ORF-Sendung „Bundesland heute“ sehen täglich 1,2 Millionen. Nicht verteilt auf 24 Stunden, sondern gleichzeitig.
Zweitens: Natürlich ist Facebook ein Massenphänomen, aber ist es auch ein Massenmedium? Eines, das Öffentlichkeit schafft? Ich beobachte mich selbst: wer sind „meine Freunde“ auf Facebook? Wem „folge“ ich auf Twitter? Meinen Online-Bekanntenkreis verbindet ein ähnliches Milieu, ähnliche Interessen. Was passiert, wenn eher Gleichgesinnte miteinander sprechen? Der bulgarische Politikwissenschafter
Ivan Krastev hat es jüngst auf den Punkt gebracht: Homogene Gruppen tendieren dazu, ihre Vorstellungen zu radikalisieren, weil das Abschleifen „am anderen“ nicht mehr passiert.
Öffentlichkeit dient dazu gemeinsame Regeln in der Stadt und im Staat zu schaffen, sich als Gesellschaft wahrzunehmen. Das funktioniert aber nur, wenn wir gemeinsam über etwas sprechen, das irgendwie alle, oder zumindest sehr viele angeht. Schaffen das Facebook und Twitter?
Oder – und das ist meine dritte Frage – leisten sie nicht vielmehr einem neuen Tribalismus Vorschub? Unser Staat baut auf einem gemeinsamem Verständnis von Demokratie auf. Dafür braucht es auch Massenmedien, die unser Interesse auf Gemeinsames lenken. Wenn Twitter und Facebook zu einer Fragmentierung führen, was wird diese in der Gesellschaft bewirken?
Jüngst meinte die Jugendforscherin Beate Großegger im Falter: „Im Interview mit einer 18-Jährigen hatte ich ein Aha-Erlebnis. Wir sprachen über Gesellschaftspolitik, und sie wusste nicht so recht, worauf ich hinaus will. Ich fragte: 'Was verstehst du unter Gesellschaft?' Sie meinte: 'Na ja, meine Familie, meine Freunde, das ist meine Gesellschaft-'
Jetzt zwickt der Platz. Es gäbe noch weiteres Wichtiges, auch zur Ökonomie, zu hinterfragen. Auf meinem Blog geht’s weiter. Bitte kurz umschalten: chorherr.twoday.net
soweit im falter. jetzt bitte weiterlesen
Zwei weitere mir wichtige Themenkomplexe:
Da ist einmal die Ökonomie. Wiederum zugespitzt:
Jene Zeitungen, die sich auf ihr Kerngeschäft, die qualitätsvolle Gestaltung eines Massenmediums konzentriert haben, können, entgegen anderslautenden Anschauungen sogar deutlich Reichweite gewinnen sowie profitabel wirtschaften.
Die deutsche Wochnzeitung „die Zeit“ (
deren Webauftritt ist bescheiden und kaum besucht) ist ebenso ein Beispiel wie der Wiener „Falter“.
Zeitungen, die irrigerweise glaubten, ihre primäre Aufgabe v.a. im Netz suchen zu müssen (wo klassisch massenmediale Verbreitung die Ausnahme und nicht die Regel ist) und dazu auch Unsummen an Geld verbraten haben, die stecken heute in Schwierigkeiten.
Ein Beispiel: Die
New York Times. Allein für den Ankauf des läppschen Portals
about.com wurden rund 500 Mio Dollar investiert. Die fehlen heute. Oder andersherum: Wie könnte heute das Blatt aussehen, wären sie ins Kerngeschäft geflossen?
Weiteres Beispiel, der
economist; Ich halte ihn für eine der besten (wenn nicht „die“ beste) Wirtschaftszeitung der Welt.
Dieser Tage wurde ein mail an alle Abonnenten versandt, mit der Botschaft, dass man demnächst den „freien Onlinezugang" bloss denen anbiete, die (ein Abo) bezahlen.
Ist das nicht verständlich? Wie soll langfristig eine teure Redaktion, Korrespondenten, v.a. auch Zeit für sorgfältige Journalisten bezahlt werden, wenn das Ergebnis gratis im Netz zu konsumieren ist.
Das kann kein Geschäftsmodell sein.
(Ich hab viel economist gelesen, ihn mir kaum gekauft. Ebensowenig wie die New York Times, die Sueddeutsche oder andere Qualitäts“blätter“.Ich konsumiere sie gratis im Netz.
Demnächst, wenn der economist online nicht mehr verfügbar ist, werd ich wieder ein Abo bestellen.)
Das Ergebnis des wirtschaftlichen Abstiegs von Zeitungen kann uns nicht egal sein.Ihre Qualität sank und wird weiter sinken, wenn ihre Erlöse zurückgehen.
Also ewig Papier?
Nein und Ja.
Ähnlich wie Steve Jobs und die Musikindustrie wird es bald kundenfreundliche kostenpflichtige digitale Angebote geben.
Mit dem „
Kindle“ oder ähnlichen Endgeräten, die weitaus lesefreundlicher als ein flimmernder Computerscreen sind, gibt es auch schon die Richtung.
Aber Print wird bleiben, wie es heute noch und wieder Vinylplatten gibt, trotz Fernsehn und DVD noch immer das Kino, ja sogar noch das Theater gibt.
Print wird mehr ein „Kunstprodulkt“ werden, und sich auch entsprechend umpositionieren müssen.
Einfach zu verlangen, „schenkt`s alles her“ ist sicher keine Basis.
Mein letzter „kritischer“ Punkt zu „social media“.
Man muß nicht paranoid sein, um sich vorzustellen, was heute alles über Individuen gespeichert wird. Nicht weil sie überwacht werden, sondern weil , meist völlig unkritisch nahezu alles freiwillig ins Netz gestellt wird. Hobbies und Vorlieben, Intimstes und Berufliches, Aufenthaltsorte zu fast jeder Zeit, nichts wird nicht berichtet.
George Orwell würde vor Entsetzen umfallen, wenn er wüßte, was an lückenlosester Überwachung heute möglich ist, weil freiwillig alles preisgegeben wird.
Gerald Reischl ist kein Maschinenstürmer, im Gegenteil, er ist Experte für digitale Medien, schreibt für den Kurier und hat die
Googlefalle geschrieben. Es ist unbeschreiblich, was dieser Konzern über uns alles weiss.
Und wehe, wenn sie losgelassen.
Und abschliesend nur zum Nachdenken: Unsere Privatheit, die eben nicht alle angeht, mit der wir nicht alle belästigen müssen, auch die ist längst abgeschafft.Das liegt auch im Wesen dessen, was web 2.0 letztlich ist.
Wir stehen am Anfang einer Revolution unserer Kommunikation.
Ich muß mich wiederholen. Ich erlebe social media für meinen Beruf, für meine Interessen als enorm bereichernd. Web 2.0 hat mein Leben auf vielfache Weise verändert, bereichert, mir Ideen und Menschen nähergebracht, mich in Gespräche verwickelt, die ich nur lobpreisen kann.
Aber es wäre töricht, sie nur aus meiner Sicht zu betrachten.
Eine fundierte, kontroverse Debatte, wie diese Medien unser Leben, unsere Demokratie, unsere Freizeit, unsere Art miteinander zu verkehren verändert muß geführt werden.
freu mich darauf