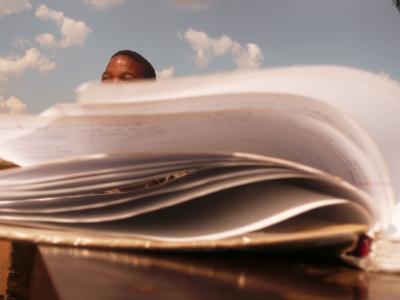Zwischen Wahlvorbereitungen:
Mein Artikel über Südafrika im aktuellen
falter
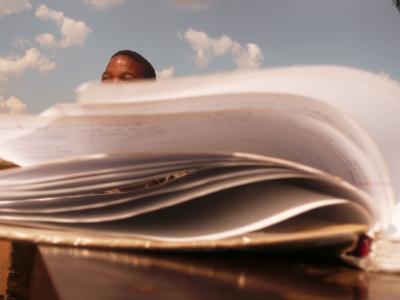
AFRIKAS EUROPA
In welchem Land findet die erste WM Afrikas statt? Jedenfalls in keinem, wo man die Wirklichkeit nur schwarz und weiß malen kann. Sieben Bilder aus Südafrika
1. Der Doppeldecker
Zwei Flügel tragen das Land. Aber die beiden haben fast nichts miteinander zu tun; es gibt zwar Verbindungen, aber die sind sehr dünn. Der „obere“, das war und ist das weitgehend weiße Südafrika. Erste Welt. Industrienation. Wenn schon nicht Reichtum, so doch ausreichend Wohlstand. Gute Schulen, beste Krankenversorgung, Haus mit Pool, Garten und Bediensteten, sicherer Job bei Banken oder Rohstoffunternehmen oder einem jener globalen Akteure von Toyota bis Coca-Cola, die in Südafrika produzieren.
Der „untere“ Flügel ist fast ausschließlich schwarz.
Er lebt im Township, und dieses ist zumindest doppelgesichtig. Da springt uns Europäern eine Armut ins Auge, die sprachlos macht: Statt die Wellblechhütten, die extrem hohe Arbeitslosigkeit, die mangelnden Sanitäreinrichtungen und die fast ungebremst grassierende Aids-Pandemie zu beschreiben, sei bloß folgende selbst erlebte Geschichte erzählt:
Mit einem europäischen Studenten in einem lokalen Spital. Untersuchung plus lokale, ausgezeichnete Behandlung: 75 Euro. Man zückt erleichtert seine Kreditkarte. Während des Wartens erscheint eine schwarze Familie, das Kind sichtbar krank, und bittet die junge weiße Ordinationshilfe um Unterstützung. „Haben Sie eine Krankenversicherung?“, „No, Ma’am!“, „Können Sie bezahlen, die Erstuntersuchung kostet 220 Rand (etwa 25 Euro)?“, „No, Ma’am, but please help my child!“ Die Weiße extrem freundlich: „So können wir Sie hier nicht behandeln, versuchen Sie es doch im public hospital.“ Es folgt eine genaue Wegbeschreibung. „Dort waren wir bereits, Ma’am“, lautet die Antwort. „Eine Behandlung bekommen wir dort erst nach tagelangem Warten, drum sind wir hier!“ Und nochmals: „Please help my child!“ Die Sprechstundenhilfe entschuldigt sich tausendmal und erklärt, dass dies ohne Bezahlung oder Krankenversicherung hier nicht möglich sei. Die schwarze Familie bricht entmutigt wieder auf. „Sie haben keine Ahnung, was ich hier alles erleben muss. Es ist schrecklich“, wendet sich die Weiße an den Autor dieser Zeilen, der zum wiederholten Male darüber nachdenkt, welch unfassbare zivilisatorische Errungenschaft eine allgemeine Krankenversicherung darstellt.
2. Die schwarzen Diamanten
Reichtum, Vermögen sowie Grund und Boden sind noch immer fest in weißer Hand. Jahrzehntelange systematisch umgesetzte Apartheid hat das Land und die Gesellschaft tief geprägt. Der Unmut in den Townships darüber ist groß – und wächst. Affirmative action, hier black economic empowerment (BEE) genannt, soll Abhilfe schaffen, und scheitert grandios. Gründet ein Weißer ein Unternehmen, muss er einen schwarzen Partner dazunehmen. Möchte ein weiß dominiertes Unternehmen (und das ist die überwiegende Mehrheit) einen öffentlichen Auftrag, müssen Firmenanteile an Schwarze abgegeben werden.
Gut, sehr gut gemeint und die Intention: mehr als verständlich.
Aber die Praxis zeigt: BEE bewirkt das Gegenteil von gut. Das behaupten übereinstimmend Weiße wie Schwarze: Der (gewiefte) weiße Unternehmer erkundigt sich „politisch“, wen er denn in sein Unternehmen hereinnehmen solle. Diesen versorgt er dann mit ausreichend Einkommen, aber hält ihn vom Geschäft fern, denn das lässt sich angesichts der Qualität der Schulen nicht so leicht erlernen.
Diese Praxis erzeugt eine Schicht von black diamonds, eine kleine Schicht politisch gut vernetzter Schwarzer, die rasch zu Reichtum kommt. An der Grundverteilung im Land wird kaum Substanzielles verändert. Die Mehrheit der Townshipbewohner hat nichts davon. Auf weißer Seite wachsen Enttäuschung und Zorn. Im öffentlichen Dienst oder in Spitälern haben junge weiße Männer das berechtigte Gefühl, angesichts dieser Form von affirmative action nahezu chancenlos zu sein, was ihre Karrieren betrifft. Deutlich schlechter Qualifizierte werden ihnen systematisch vorgezogen. Viele sehen nur einen Ausweg: Sie wandern aus. Vorzugsweise nach Australien, Neuseeland oder nach Großbritannien. Das schadet dem Land enorm.
3. Zuwanderung
Südafrika gilt als das „Europa“ des südlichen Afrika. Nicht nur aus Simbabwe, wo Robert Mugabe ein blühendes Land in den Ruin getrieben hat, flohen und fliehen die Menschen nach Südafrika. Auch aus Mosambik, Swaziland und selbst aus dem fernen Nigeria oder Angola suchen die Menschen eine bessere Zukunft in der Kapregion. Die Grenze zu passieren ist nicht schwierig. Einige Millionen waren es im letzten Jahrzehnt.
Viele davon sind unternehmerisch geschickt und brachten es rasch zu bescheidenem Wohlstand. Dieser entfachte Neid, der sich in schrecklichen Verfolgungen schwarzer Migranten vor allem im Jahr 2008 niederschlug.
Manche Teile Johannesburgs kennt und meidet man, sie werden von Kriminellen, oft illegalen Einwanderern, dominiert. Gerade schwarze Südafrikaner leiden unter der grassierenden Gewalt. Und was es noch schlimmer macht: Es gibt kein Gespräch unter Weißen, bei dem nicht mit geradezu wollüstigem Schauer wieder und immer wieder penibel erzählt wird, bei wem wie eingebrochen oder geraubt wurde. Auch die Zeitungen kennen vor allem eines: Berichte über Gewalt.
Das verursacht Angst, die sich im Antlitz der Stadt niederschlägt. Meterhohe Zäune, Stacheldraht, abgeriegelte Straßen, gated communities, ein Heer an privaten Sicherheitskräften. Das ist der Tod des öffentlichen Raums, der ja eigentlich das Städtische ausmacht. Weiße fahren fast ausschließlich mit dem Auto, Freizeit verbringt man am Land oder im Shoppingcenter.
4. Der Stau
Bis vor kurzem war das private Minitaxi das einzige öffentliche Verkehrsmittel in Johannesburg. Japanische Kleinbusse, bei uns für neun Personen zugelassen, werden hier mit 22 Personen in fünf Reihen befüllt und transportieren gegen hohe Tarife die Menschen aus den Townships in die Stadtzentren und wieder zurück. Da Weiße wie auch alle Schwarzen, die irgendwie zu Wohlstand gekommen sind, ein Auto haben, gehört der Stau zum Alltag.
Erst dieser Tage wurden zwei neue Öffis in Betrieb genommen. Eines ist ziemlich schlau, das andere, tja, eher das Gegenteil:
Das schlaue ist das beschleunigte Bussystem, in der brasilianischen Stadt Curitiba entwickelt und heute im kolumbianischen Bogota und Dutzenden anderen Städten von Entwicklungsländern erfolgreich angewandt. Straßen bekommen großzügige, baulich getrennte Busspuren, um ein rasches öffentliches Fortkommen zu ermöglichen. Fast wäre diese Idee in Johannesburg an den Taxiunternehmern gescheitert, die wegen der Konkurrenz heftig dagegen protestierten und Streiks ausriefen, die das Land lahmlegen könnten. Erst als man einigen von ihnen Unternehmensanteile an diesen Buslinien versprach, lenkten sie ein.
Das zweite ist das absurd teure Projekt „Gautrain“ in Johannesburg. Es ist eine U-Bahn-artige Verbindung, die den Flughafen von Johannesburg mit Santon, dem weißen Stadtzentrum, und Pretoria, der 60 Kilometer nördlich gelegenen Hauptstadt, verbinden soll. Sowohl Qualität wie Preisgestaltung dieser wenigen Linien zielen eindeutig auf ein wohlbestalltes Publikum, statt flächenhaft die Townships zu erschließen, zum Beispiel mit günstigen Stadtbahnen. Die Kosten beim „Gautrain“ sind genauso explodiert wie bei unserem heimischen Skylink. Dass etliche Minister Anteile an diesem Projekt besitzen, zeigt, wie schwierig es ist, eine sparsame Verwaltung und Vergabekultur zu entwickeln.
Aber als Österreicher sollten wir hier mit Kritik sparen, sitzen wir doch im sprichwörtlichen Glashaus.
5. Die Townshipschule
Die Fairness gebietet es festzuhalten: Seit dem Ende der Apartheid ist sehr viel geschehen in Südafrika, auch in den Townships. Schulen, Häuser und Krankenhäuser wurden gebaut, die Anzahl der Südafrikaner mit Strom und Wasser hat sich deutlich erhöht. Trotzdem: Die Qualität vieler Townshipschulen ist nach wie vor inferior. Dafür lassen sich viele Erklärungen finden, von der Apartheid, die Schwarze systematisch (nicht nur) von höherer Bildung ausgeschlossen hat, bis zu Aids, die zu Zehntausenden auch Lehrer hinwegrafft, und der hohen Zuwanderungsrate.
Aber da Südafrika eine Zentralmatura hat, lassen sich Schulen leicht vergleichen. Und obwohl die Standards dieser Matura laufend abgesenkt werden, und für manche sogar Mathematik durch die leichtere Form „mathematic literacy“ ersetzt wurde, sinkt die pass-rate bei der Matura in den Townships immer weiter. 90 Kinder und mehr finden sich nicht selten pro Klasse. Viele können nach neun Pflichtschuljahren kaum sinnzusammenhängend lesen und schreiben.
Man muss der Politik zugutehalten, dass sie dieses Thema öffentlich diskutiert und viel Geld für Bildung verwendet wird. Bislang jedoch ohne Erfolg. Auch hier herrscht wachsende Ungleichheit. Wer es sich leisten kann, ob weiß oder schwarz, schickt sein Kind in eine teure Privatschule.
6. Das Handy
Nahezu jeder hat eins. Nicht nur in den Townships Johannesburgs, sogar an der totalen Peripherie: An der wild coast am Indik, einer unbeschreiblich schönen Küstenregion im Eastern Cape, dem ärmsten der neun Bundesländer, lebt das Volk der Pondos heute noch wie vor 100 Jahren von Subsistenzlandwirtschaft. Keine befestigte Straße führt zu ihren Siedlungen, kein Stromnetz. Aber sie alle haben ein Handy, das ihnen auch den Einstieg in einen bescheidenen, Community-getriebenen Tourismus eröffnet hat. Eine winzige Solaranlage wird vor die Hütte gestellt, welche eine Batterie mit Strom lädt, die ihrerseits Handys versorgt. „Warum“, so fragt der neugierige Reisende, „stehen wenige Meter neben dem jetzt bewohnten Dorf so viele verfallene Hütten?“ Erst ein Lächeln, dann die Antwort: „Dort haben wir vor kurzem gelebt, aber da ist heute kein Empfang mehr.“
Eins wird klar in Afrika: Nicht der Computer, das Handy wird das Endgerät des globalen Kommunikationszeitalters sein.
7. Kohle
In Südafrika scheint die Sonne. Im kalten Winter, wenn der Stromverbrauch wegen der Elektroheizungen (solares Bauen kennt man kaum) dramatisch steigt, scheint sie besonders intensiv vom immer wolkenlosen stahlblauen Himmel. Aber eines hat sich seit Jahrzehnten kaum geändert: Strom kommt fast ausschließlich aus Kohlekraftwerken. Heute hat Südafrika deswegen einen besonders hohen CO2-Ausstoß. Denn Kohle gibt es genug.
Es wäre ein Leichtes, die großen Wüstenflächen des Landes mit einem Solarprojekt zu nutzen, wie dies etwa das Projekt Desertec in der Sahara vorsieht. Doch noch hat das Umdenken kaum eingesetzt. „Öko“ ist nur insofern am Kap gelandet, als Plastiksackerln in Geschäften Geld kosten.
Ausblick
„Give us 10.000 days“, meinte jüngst ein weiser schwarzer Lehrer, der auf die enormen Probleme seines Landes angesprochen wurde. „Then we’ll fix it.“ We will.